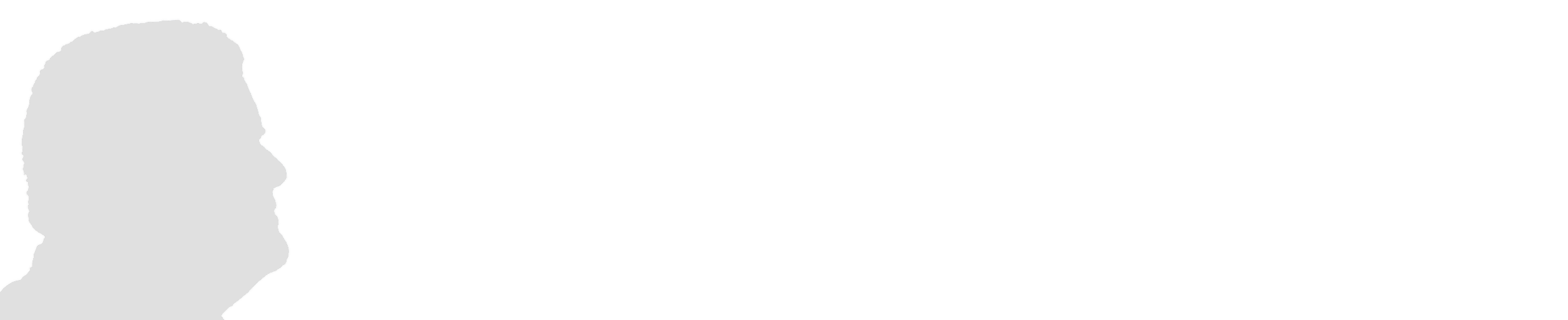I.
Die Politik verliert ihre Kinder.
In den Wochen vor der Europawahl konnte sich der Eindruck nahelegen, dass politische Parteien unterschiedlicher Couleur unsicher und wie im Halbschlaf auf eine Zukunft zugingen, die ihnen obsolet war. Auf der Oberfläche ist dies eine Frage der Kommunikationsmedien und-geschwindigkeiten. Sie ist dramatisch genug, wenn die Wahlkampfzentralen einer großen Volkspartei dem Video eines Youtubers ausgesetzt sind und erst hilflos, dann beleidigt reagieren. Bei tieferer Analyse zeigt sich, dass Parteien in fortgesetztem Maß ihre angestammten Wähleridentitäten und -milieus verlieren, was zu schmerzhaften Erosionen und Einbrüchen an Stimmenanteilen führt, wie sie vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Die Sozialdemokratie ist davon derzeit besonders akut betroffen. Doch könnte es nur eine Frage der Zeit sein, dass sich auch die aus dem 19. Jahrhundert stammenden Verbindlichkeiten des Liberalismus und des bürgerlichen Konservatismus ähnlich dramatisch überleben.
Dabei treten Ungleichzeitigkeiten des Gleichzeitigen zutage: Mit ihrer „Internationale der Nationalisten“ kapern die Rechtspopulisten und -extremisten eine Maxime aus der Frühphase des Marxismus und wenden den Internationalismus gegen seine eigene Idee. Die logische Unhaltbarkeit einer solchen Bewegung liegt auf der Hand: Wo der nationale Imperativ internationalisiert und zu einer Art kategorischen Imperativs überhöht werden soll, ist wechselseitige Konfrontation und Lähmung die Konsequenz. Kein Europa der Vaterländer, sondern die Konstellationen von 1914 liegen in der Fluchtlinie solcher Träume. Die Absurdität solcher Vorstellungen hindert nicht an ihrer zumindest vorübergehenden Akzeptanz.
Bei manchen Reaktionen auf den Wahlausgang hatte man den Eindruck der Reiter, die gerade den Bodensee überquert hatten und einigermaßen froh zu sein, dass sie noch einmal, mit Blessuren, davongekommen waren, dass die Spaltung durch den alt-neuen Nationalismus nicht so massiv ausgefallen war wie befürchtet. Man will sich noch einmal sortieren, die Felder neu ordnen.
Doch zugleich zeigt sich ein verändertes politisches Paradigma, das die alten Muster und Denkgewohnheiten aufsprengt, das Handlung und Reflexion nicht mehr den selbst ernannten „Experten“ überlässt und das auch den ‚Revolutionen von oben‘ wie dem Movement von Präsident Macron schneller den Kredit entzieht, als man dies erwarten konnte. Dies entzündete sich am Paradigma des Klimawandels; vordergründig bedeutet es den Triumph einer neuen, eher grünen, bürgerlichen Mitte. Doch das Paradigma reicht weit über Parteipolitik hinaus.
II.
Aufregend und faszinierend ist, dass sich hier neue, und vielleicht zugleich sehr alte Konturen einer konsequent demokratischen Politik erneut Geltung verschaffen, die, frei von Ressentiment und intelligent, auf Partizipation und Wechselseitigkeit orientiert ist.
Politik wird eine Angelegenheit der Vielen, gerade der Jungen, die die Agenda von Tag und Stunde selbst besetzen und sich, über Nationen, Kultur- und Religionskreise hinaus vernetzen und verflechten. Das eigenste individuelle Anliegen ist zugleich das allgemein menschliche Anliegen, die Welt als globales Haus (Oikos) zu erhalten.
Differenzierte Überlegungen über Möglichkeiten und Gefahren einer Weltrepublik und ihre Verfassung, wie sie seit Jahrzehnten von Völkerrechtlern und Philosophen angestellt werden, sind dadurch nicht zur Makulatur geworden. Doch wenn sie weitergehende Regeln und Rechtswege eines übernationalen Konsenses zu etablieren haben, dann geschieht das nicht mehr als Konstruktion am grünen Tisch, als Eliteprojekt, das „die Menschen mitnehmen“ müsse. Die Konturen eines globalen Weltbürger-bewusstseins zeichnen sich seit den vergangenen Monaten zunehmend bereits ab. Vermittelt durch junge Bürgerinnen und Bürger, die an einem besonders brisanten Problemfeld: dem Fortbestand einer bewohnbaren Welt, sich selbst artikulieren. International, transparent, überzeugend. Verantwortbare Politik unterscheidet in dem neuen Pardigma nicht mehr primär nach Checks und Balances, nach Einfluss-Sphären und der Hegung der alten Feindschaften: Ihr Rayon ist der blaue Planet selbst und das gemeinsame menschliche in-der-Welt-sein. Universalismus ist dann kein abstrakter Imperativ, zu dem man erst erzogen werden müsste, sondern Ausdruck des wohlverstandenen Eigeninteresses; Idealismus und Realismus spielen unvermittelt ineinander. Wenn sich dies überzeugend durchhält, kann es einen Paradigmenwechsel bedeuten, der die schöne Kantische Maxime von der „Menschheit in meiner eigenen und jedes/jeder anderen Person“ in ein individuelles Bewusstsein konkretisiert und inspiriert.
Als Ideologie und Hysterie der Unprofessionellen wird man dies kaum abtun können, wie es noch immer geschieht. Denn eine grundlegende Maxime des jungen Movements von unten besteht darin, nachprüfbaren wissenschaftlichen Aussagen zu folgen, sich über seine eigenen Behauptungen Rechenschaft ablegen und Gründe geben zu können. Sie durchbrechen damit die Echoräume und geschlossenen Binnenlogiken, die zur Spaltung europäischer Gesellschaften in den vergangenen Jahren wesentlich beigetragen haben.
Daraus entsteht eine Dynamik, die die Ängstlichkeit der gerade noch einmal davongekommenen, abgewählten Reiter über den Bodensee in Rhythmus und Klang konterkariert.
Insofern sich ein neues Paradigma abzeichnet, bedeutet die Europawahl einen ‚Kairos‘, glücklicher und entscheidender Augenblick, vielleicht in jüngerer Zeit dem Kairos der friedlichen Revolutionen von 1989 vergleichbar, der in der operativen Politik allzu wenig Fortsetzung fand. Der noch vor-griechischen Bedeutung folgend, bedeutet ‚Kairos‘ allerdings nicht nur den vorüberziehenden Moment, sondern die eine grundlegende Harmonie in Austausch und Wechselseitigkeit, wie sie die alteuropäischen Zivilisationen vor mehr als 3000 Jahren auszeichneten. Auch diese Semantik hat einen guten Sinn.
Zugleich bezeichnet sie aber eine Krisis: weil auch die Logik von Spaltung und Ressentiment, und die Verschwörungstheorien von geschlossenen Echoräumen ein hohes Aktivierungspotenzial zeitigten.
III.
Kairos und Krisis erfordern ein Weiterdenken und-handeln im Horizont der Europawahlen. Nach wie vor wird demokratische Politik auf Mühen der Ebene angewiesen bleiben, werden Mehrheiten zu organisieren sein und bleibt Expertenwissen erforderlich. Doch wenn der Kairos trägt, hört Europa auf, ein kaltes, in Bürokratien erstickendes „Cold Project“ zu sein, dem das existenzielle Narrativ zunehmend abhandenkommt. Ralf Dahrendorf, einer der großen liberalen Europäer, fürchtete dies gegen Ende seines Lebens als reale Aussicht.
Dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass sich Europa nach den Vernichtungen des 20. Jahrhunderts als großer Friedensraum darstellt, haben die erneut aufbrandenden Nationalismen während der letzten Jahre gezeigt. Die jüngere Generation hat die Chance, diese Selbstverständlichkeit mit einem neuen Narrativ zu erfüllen: Einer verbindenden weltbürgerlichen Perspektive, in der der eigene Friede und das eigene Glück auch das Glück des anderen sind, ja in der ich mich an seine/ihre Stelle versetzen muss, wenn ich ich selbstsein will. Paul Ricoeur schrieb von zwei Jahrzehnten ein bemerkenswertes Buch ‚Soi-même comme un autre‘: Ich selbst als Anderer. Poetisch variiert Ingeborg Bachmann diese Aussage in ihrem 1968 verfassten Gedicht über ‚Böhmen am Meer‘: „Bin ich’s nicht, so ist’s ein andrer, der ist so gut wie ich“. Nicht Gleichgültigkeit, sondern anerkennende wechselseitige Egalität ist der Impetus!
Diese Denkfigur kann einer künftigen europäischen Politik neue Glut und Inhalt geben – und sie wird nicht an geographischen Grenzen Europas Halt machen: zumal dann nicht, wenn man sich der Maxime Edmund Husserls, des großen Phänomenologen am Ende seines Lebens erinnert, dass der Sinn Europas die Einsicht sei. Natürlich wird sie nicht monothematisch bleiben können, sondern auch die (nicht zu vernachlässigenden) Felder von Außen-, Sicherheits- und Sozialpolitik sich aneignen müssen: nicht frei von Mühe, aber aus einer veränderten Optik, einem Gesamtblick.
Den Rissen und Erosionen, den Ängsten und Ressentiments wird man nicht durch eine einhegende Politik, einen Not-und Verstandesstaat, Paroli bieten können, sondern durch eine neue Dynamik.